- Raubkopien: Unlizenzierte Software in Unternehmen und die Folgen
- Lidl SilverCrest Mehrfachsteckdose mit Hue / deCONZ koppeln
- "brew" im Terminal: HomeBrew installieren!
- IT-Lösungen im Unternehmen: welche Software ist wichtig?
- OpenStreetMap, die Open-Source Straßenkarte
- Windows 10 und Windows Server – die Unterschiede in der Übersicht
- Daten-Transfer vom Computer zum Notebook (zwischen zwei PCs)
Raubkopien: Unlizenzierte Software in Unternehmen und die Folgen

Foto von John Schnobrich auf Unsplash
Im Krisenfall versuchen gerade mittelständische Unternehmen nach Möglichkeit zu sparen. Viele halten es dann auch für eine gute Idee, die Ausgaben im IT-Bereich durch den Einsatz von unlizenzierter Unternehmenssoftware zu senken. Dabei bedenken viele nicht, dass dies nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Die illegale Software geht meistens auch mit enormen Sicherheitsrisiken einher. Denn teilweise verbreiten Cyber-Kriminelle kopierte Originalsoftware, um damit schädliche Dateien in die Unternehmen einzuschleusen. Damit setzen die Unternehmen nicht nur die Sicherheit aufs Spiel, sondern ihre Reputation und ihre Einkommensquelle ebenso.
Was passiert, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt?
Wer in den Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gerät, muss mit einigen Unannehmlichkeiten rechnen. Die Staatsanwaltschaft darf in einem Unternehmen die gesamte Computeranlage beschlagnahmen, um Beweise sicherzustellen. Wird ein Unternehmen verurteilt, kann sogar laut Urhebergesetz die Computeranlage eingezogen werden. Es drohen nicht nur strafrechtliche Konsequenzen. Der Hersteller der Originalsoftware kann auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Meist ist mindestens die Lizenzgebühr nachzuzahlen. Werden Raubkopien vertrieben oder Software illegal zum Download bereitgestellt, kann das sehr teuer werden.
Welche Risiken gehen Unternehmen ein, die unlizenzierte Software nutzen?
Neben den rechtlichen Konsequenzen kann die Nutzung unlizenzierter Software auch weitreichende Konsequenzen in den Unternehmen haben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas über 20 Prozent steckt Malware in der illegalen Software. Dadurch entstehen den betroffenen Unternehmen enorme Kosten, direkte Kosten und Kosten von Datenverlusten. Zudem ist das Risiko hoch, auch geistiges Eigentum auf diese Weise zu verlieren. Das lässt sich vermeiden, indem Unternehmen legale Software erwerben, wie beispielsweise einem Office 2021 Key für die Verwendung der Microsoft-Office-Produkte.
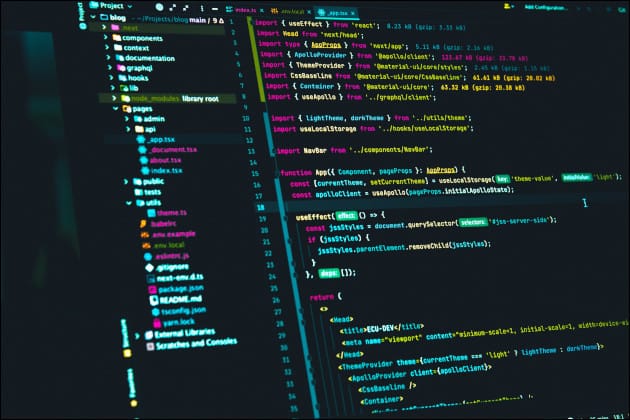
Foto von Juanjo Jaramillo auf Unsplash
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass das Produkt nach einiger Zeit nicht mehr nutzbar ist. Beispielsweise kann es vorkommen, dass es nicht möglich ist, das Produkt erneut zu aktivieren, wenn eine Neu-Installation notwendig war, weil Microsoft den Missbrauch festgestellt und den Aktivierungscode gesperrt hat.
Darüber hinaus haben Nutzer von unlizenzierter Software keinen Anspruch auf Support durch den Anbieter. Kommt es zu Problemen mit der Software, ist der User aus sich selbst gestellt. In Unternehmen kann das weitreichende Konsequenzen haben, wenn eine Software unternehmensweit im Einsatz ist.
Nutzung unlizenzierter Software verstößt gegen das Urheberrecht
Die Softwarehersteller haben das Recht, rechtliche Schritte gegen die illegale Softwarenutzung einzuleiten. Denn die User unlizenzierter Software verstoßen gegen das Urheberrechtsgesetz. Bei schuldhaftem Handeln, auch bei Fahrlässigkeit, ist der Nutzer zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet. Das kann den Nutzer gleich doppelt treffen. Zum einen muss er die legale Software-Version erwerben und sozusagen „nachlizenzieren“. Zum anderen muss er Schadenersatz an den Rechteinhaber zahlen. Obendrein macht er sich strafbar, was dann auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann.
Welche Formen illegaler Software gibt es?
Illegale Software gibt es in verschiedenen Formen:
- Raubkopien sind der Klassiker. Sie stehen zum Verkauf. Als Datenträger dienen meist DVDs oder andere optische Datenträger, die kaum vom Original zu unterscheiden sind. Oft sind es aber auch ganz offensichtliche Raubkopien auf einem selbst gebrannten DVD-Rohling oder einem anderen Speichermedium.
- Für einzelne Bestandteile eines Produkts, beispielsweise aus den Microsoft-Softwarepaketen, können User eine „Lizenz“ erwerben. Beispielsweise bieten die Software-Piraten sogenannte Certificates of Authenticity (COAs) an. Doch bei diesen Echtheitszertifikaten handelt es sich gar nicht um eine Lizenz. Der Verkauf verstößt gegen das Markenrecht.
- Vielfach gibt es auch Product Keys, die keine Nutzungsrechte für die Software beinhalten, und demzufolge auch keine Nutzungslizenz sind. Mit dem Product Key können User die Software aktivieren, wenn sie ein Nutzungsrecht haben, das vertraglich oder gesetzlich sein kann.
- Unter ganz bestimmten Voraussetzungen darf der Product Key zusammen mit den Nutzungsrechten an einen anderen Nutzer weiterübertragen werden. Diese Form der Nutzung „gebrauchter“ Software ist absolut legal und sehr weit verbreitet.
Software-Lizenzen aus zweiter Hand sind eine rechtssichere und kostengünstige Lösung
 Von Gebrauchtsoftware zu reden, ist etwas irreführend, denn die Nutzung einer Software hat keinerlei Abnutzungserscheinungen zur Folge. Die Funktionen bleiben komplett erhalten. Der User erhält Support vom Hersteller und hat auch Anspruch auf die regelmäßigen Sicherheits-Updates. Mit dem Erwerb einer Lizenz von gebrauchter Software gehen alle Rechte, inklusive Aktivierungsschlüssel, an den Käufer über. Damit können Unternehmen bis zu 70 Prozent der Kosten für konventionelle Büro-Software sparen.
Von Gebrauchtsoftware zu reden, ist etwas irreführend, denn die Nutzung einer Software hat keinerlei Abnutzungserscheinungen zur Folge. Die Funktionen bleiben komplett erhalten. Der User erhält Support vom Hersteller und hat auch Anspruch auf die regelmäßigen Sicherheits-Updates. Mit dem Erwerb einer Lizenz von gebrauchter Software gehen alle Rechte, inklusive Aktivierungsschlüssel, an den Käufer über. Damit können Unternehmen bis zu 70 Prozent der Kosten für konventionelle Büro-Software sparen.
Im Oktober 2016 hat der Europäische Gerichtshof den Verkauf von Lizenzschlüsseln mit Original-Datenträgern erlaubt. Die sogenannten Reseller bewegen sich damit auf legalem Terrain. Da es mittlerweile ein breites Angebot an Originalsoftware zum Download gibt, entfällt der Original-Datenträger.
Die Reseller bekommen ihre Secondhand-Produkte aus Überbeständen oder Großabnahmen, die in unterschiedlich großen Unternehmen immer wieder anfallen. Gründe dafür können Umstrukturierungsmaßnahmen sein. Aber auch Fehlkalkulationen oder Insolvenzen können eine erhebliche Menge ausmachen.
Dokumente für den Erwerb gebrauchter Lizenzen
Unternehmen, die sich für gebrauchte Software entscheiden, sollten darauf achten, dass der Händler folgende Unterlagen vorlegt. Seriöse Händler legen ohne weitere Aufforderung Rechnung und Lieferschein vor. Sie haben Kopien der Lizenzverträge und können auf Anfrage ein offizielles License-Statement des Lizenzgebers vorlegen.
Hat der Käufer einen Screenshot-Auszug aus dem Volume Licensing Service Center, lässt sich mithilfe von Produkt, Vertragsnummer und Aktivierungsschlüssel des Volumenlizenzvertrags nachvollziehen.
Wichtig ist auch eine schriftliche Vernichtungserklärung oder eine Bestätigung der Deinstallation des Vorbesitzers. Damit ist sichergestellt, dass die Lizenzen wirklich nicht mehr in Gebrauch sind.
Fazit
Wer an der Software sparen will oder muss, sollte das richtig machen. Mit originalen Software-Lizenzen, neu oder gebraucht, sind User immer auf der sicheren Seite. Unternehmen machen sich nicht strafbar und gehen zudem keine Sicherheitsrisiken ein. Im schlimmsten Fall kommt über eine Sicherheitslücke, die mithilfe des jüngsten Sicherheitsupdates geschlossen wurde, ein Trojaner ins System. Dieser kann Daten löschen, von denen es kein Backup gibt, oder wichtige Daten, wie die Entwicklung eines neuen Produkts, stehlen. Häufig kommt es in diesem Zusammenhang zu enorm teuren Erpressungen, vor denen sich die Unternehmen durch die Verwendung legaler Software weitgehend schützen können.
- pc-einsteigerkurs (24x gelesen)
- datenschutz (11x gelesen)
- Jobs: Developer-Jobs (9x gelesen)
- pc-einsteigerkurs-1-2 (5x gelesen)
- pc-einsteigerkurs-3-2 (5x gelesen)
Mehr Tipps zu Raubkopien: Unlizenzierte Software i...
-
Automatisierte EÜR-Rechnungen in der Buchhaltungssoftware – welche Vorteile bringen sie?
Quelle: Shutterstock @Tetiana Yurchenko Wer selbst schon einmal eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung machen musste, der weiß, wie zeitaufwendig eine solche sein kann. Glücklicherweise erstrecken sich mittlerweile innovative...
-
Viren, Schadsoftware und Hackerangriffe – wie gelingt ein effektiver Schutz?
Wer schon einmal einen hartnäckigen Virus hatte oder Opfer eines Kontodiebstahls war, der weiß, wie schlimm solche Situationen sind. Ein kompletter Datenverlust oder sogar hohe...
-
Homeoffice als Selbstständiger: Wie Nutzer günstig an neue Software kommen
Gerade Online-Unternehmen können heute quasi mühelos ein eigenes Unternehmen aus dem heimischen Wohnzimmer gründen. Die Hürden sind, natürlich abhängig von der Art des Betriebs, nicht...
-
Der Unternehmensblog als Marketinginstrument: Lohnt sich das?
Im E-Commerce ist es gar nicht so einfach, einen direkten und möglichst persönlichen Kontakt zum Kunden zu halten. Die nahezu unbegrenzte Reichweite des Internets birgt...
-
IT-Lösungen im Unternehmen: welche Software ist wichtig?
Die Informationstechnologie (IT) ist eigentlich schon in den 1990er Jahren in den Unternehmen angekommen - auch wenn viele Betriebe von sich sagen würden, die IT...
-
Linux: User zu einer Gruppe zufügen
Linux und damit auch Ubuntu, Debian oder Raspbian verwalten die Rechte auf Benutzer- und Gruppen-Ebene. Oft kann es daher wichtig sein, einen Benutzer einer zusätzlichen...
- Änderung von alten Beiträgen -- die Folgen.
Hallo,Hatte mich ja gelegentlich natürlich voll zu Unrecht, über das Ändern (bzw. "verschön...
- Welches CRM für das Unternehmen?
- Cloud Hosting für ein Unternehmen?
Hallo,ich suche einen möglichst kostengünstigen und sicheren Cloud Hosting für ein Unternehmen.Ha...
- Serverlösung für kleine Unternehmen
Raubkopien: Unlizenzierte Software in Unternehmen und die Folgen



 (Durchschnitt:
(Durchschnitt: